„Was passiert in einer logopädischen Therapie? Muss mein Kind die ganze Zeit still am Tisch sitzen und üben?“
Viele Eltern sind sich unsicher, ob Logopädie für ihr Kind das Richtige ist. Sie befürchten, dass ihr Kind sich nicht lang genug konzentrieren kann oder eine logopädische Therapie wie Schulunterricht aufgebaut sein könnte.
Logopädische Therapie bei Kindern ist sehr individuell, denn jedes Kind braucht unterschiedliche Therapiemethoden.
Damit du weißt, was dich und dein Kind in einer logopädischen Therapie erwartet, gebe ich dir hier Einblicke in 5 ganz unterschiedliche Therapiestunden.
Inhalt des Artikels
Simon vertauscht T mit K
Der vierjähriges Simon spricht den Laut T in allen Wörtern als K aus. Das klingt dann so: „Ich krinke kokal gerne Kee!“ (Ich trinke total gerne Tee.) Diese Art der Aussprachestörung nennt sich Phonologische Störung.
In der ersten Therapiephase lernt Simon, die Laute T und K voneinander zu unterscheiden. Das Sprechen von T wird erst viel später geübt, das wäre in dieser Phase noch ein zu großer Schritt für Simon.
Simon ist Dinofan, deshalb hat er viel Spaß an folgendem Therapiesetting:

Simon hört von mir Silben wie „uk“, „ta“ oder „iko“ (das ist natürlich Dinosprache). Er soll ganz genau hinhören, welches Geräusch in den Silben versteckt ist. Ein K oder ein T? Wenn Simon das Geräusch gehört hat, zeigt er dem Dino, welchen Schatzstein er fressen darf.
Luna spricht keinen Akkusativ
Die fünfjährige Luna hat eine Sprachentwicklungsstörung im Bereich der Grammatik und spricht u.a. noch keinen Akkusativ. Sie sagt also zum Beispiel: „Hast du der Igel gesehen?“ oder „Ich klettere auf der Stuhl.“
In der heutigen Therapiestunde soll Luna den Akkusativ im Kontrast zum Nominativ ganz oft hören. Dazu spielen wir Quartett (im Foto mit einem Memory), bei dem folgender Dialog entsteht:
Ich: „Hast du den Igel?“
Luna: „Ich hab der Igel nicht.“
Ich: „Den Igel hast du nicht? Schade. Wo ist bloß der Igel?“
Luna: „Gibst du mir der Frosch?“
Ich: „Den Frosch hab ich. Hier ist der Frosch!“

Bei dieser Therapiemethode ist es egal, ob das Kind „richtig oder falsch“ spricht. Ich korrigiere nicht. Das Ziel ist, dass Luna die Wörter „der“ und „den“ bei mir ganz oft im Kontrast hört und das kindliche Gehirn (vereinfacht erklärt) erkennt: „Ah, da gibt es einen Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ! Dann muss ich diesen Kontrast wohl markieren.“
Während Luna also „nur“ Quartett spielt, finden in den Spracharealen ihres Gehirns wichtige neue Verknüpfungen statt.
Lio ist 2 und spricht noch nicht
Lio ist das zweite Mal mit seinen Eltern bei mir. Er ist 2 1/2 Jahre alt und spricht bisher nur wenige Worte. Mein Ziel in dieser Therapiestunde ist es, herauszufinden, wie Lio kommuniziert und welche Meilensteine der Sprachentwicklung er schon erreicht hat.
Lios Eltern sind mit im Therapieraum. Das ist für mich in jeder Therapiestunde völlig okay, denn ich gehe immer vom Kind aus und gestalte die Therapiesituation so, dass das Kind sich wohl fühlt und gerne kommt.
Lio findet die Spielküche im Therapieraum besonders spannend. Ich lasse mich von dem Interesse des Kindes führen (Child-led Therapy) und setze mich neben Lio. Ich warte, dass Lio von sich aus mit mir Kontakt aufnimmt und beobachte, wie er mit mir kommuniziert: Nutzt er Gesten oder Blickkontakt? Nutzt er einzelne Worte zur Kommunikation? Vor allem in den ersten Therapiestunden einer Late-Talker-Therapie beobachte ich viel, um genau zu wissen, wo das Kind in seiner Sprachentwicklung steht.
Zum Schluss der Therapiestunde zeige ich Lios Eltern erste Strategien, wie sie die Sprachentwicklung von Lio auch zu Hause fördern können.
Hanna stottert
Die achtjährige Hanna ist schon seit einigen Wochen in logopädischer Therapie. Wir üben gerade einen weichen Wortbeginn, um Stottersymptome zu reduzieren. Damit Hanna diese Sprechtechnik irgendwann auch bei echten Stottersymptomen anwenden kann, üben wir sie jetzt mit dem sog. Pseudostottern: Abwechselnd ziehen wir eine Bildkarte, beschreiben das Bild und stottern den Anfang eines Wortes (das haben wir vorher geübt), dann üben wir die Sprechtechnik. Die jeweils andere hört genau zu und gibt Verbesserungsvorschläge.
Am Anfang der Therapie habe ich mit Hanna über ihre Ziele gesprochen: Was will sie erreichen? Was ist ihr wichtig? Was ist möglich?
Wir haben besprochen, welche einzelnen Schritte wir gehen, um ihre Ziele erreichen zu können? Weil Hanna genau weiß, warum die Übungen nötig sind und dadurch eine hohe innere Motivation hat, macht sie alle Übungen konzentriert mit – auch wenn es sie manchmal Überwindung kostet.
Niko lispelt
Niko (7 Jahre alt) kommt wegen eines Sigmatismus interdentalis in die logopädische Praxis: Er bildet den Laut S mit der Zunge zwischen den Zähnen („lispeln“).
Niko spürt noch nicht genau, wo seine Zunge im Mund liegt. Gemeinsam schauen wir deshalb unsere Zungen im Spiegel an und malen den Umriss einer Zunge auf Papier. Mit einem speziellen Eisstäbchen tippe ich nun vorsichtig verschiedene Stellen auf Nicos Zunge an. Nico fühlt genau hin, wo das Eisstäbchen war und zeigt mir die Stelle auf der gemalten Zunge.
Durch diese Übung schärft er seine Wahrnehmung für die Lage der Zunge und spürt genauer, wie sie sich bei verschiedenen Sprechlauten bewegt.

Dies war ein kleiner Ausschnitt in die logopädische Therapie bei Kindern. Die wichtigste Grundlage fürs Lernen ist Spaß und Motivation. Das Spiel ist deshalb (nicht nur für Kinder) ein besonders motivierender Weg, um die ganz persönlichen Therapieziele zu erreichen.

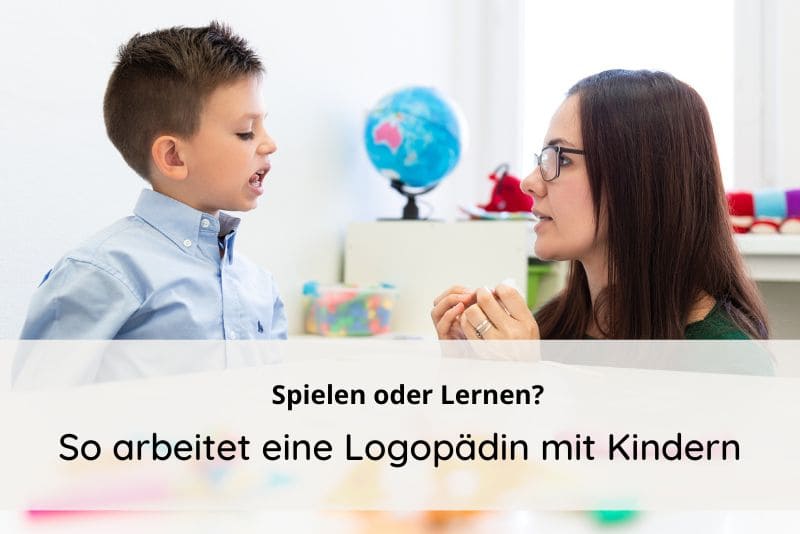


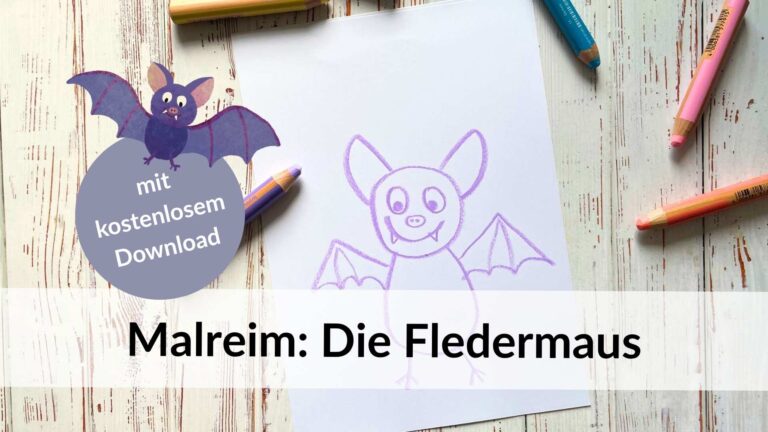

2 Kommentare zu „Was passiert in einer logopädischen Therapie? So arbeitet eine Logopädin mit Kindern“
Vielen Dank für den Einblick in ihre Praxis für Logopädie. Ich wusste gar nicht, dass in der Kindersprachtherapie so viel gespielt wird. Ich finde das allerdings sehr schön. So macht das Kind auch gerne mit.
Hallo Rudi, ja, das stimmt – dass ein Kind motiviert dabei ist und Spaß hat, ist wirklich eine wichtige Grundlage für die Sprachtherapie. Ich freue mich, dass du auf meinem Blogartikel gelandet bist. Liebe Grüße, Wiebke
Hallo, hier schreibt Wiebke!
Ich bin Logopädin, Autorin und Mutter von drei Kindern. Hier findest du Infos zur Sprachentwicklung und Tipps, wie du dein Kind beim Sprechenlernen kompetent und spielerisch begleiten kannst.
Viel Spaß beim Lesen! 🤩